 Noch heute bewundere ich, wie mein Vater sein Handwerk zum Sinn seines Lebens machte. Ein Nachruf auf den Metzgerstand.
Noch heute bewundere ich, wie mein Vater sein Handwerk zum Sinn seines Lebens machte. Ein Nachruf auf den Metzgerstand.
Erschienen in NZZ Folio 7/05
In alten Zeiten waren die Metzger als Krieger gefürchtet. Manch eine Heldengeschichte umrankt ihre sagenhafte Kraft, und stets wurde das Banner ihrer Zunft hochgehalten. Ihr Berufswerkzeug war dem des Kriegers verwandt. Um mit einem tonnenschweren Stier den letzten Weg zu gehen, ganz ohne heutige Einrichtungen und Hilfsmittel, brauchte es nicht nur Mut, Kraft und Geschicklichkeit, es brauchte auch die Axt und das Messer, und zwar beides tödlich scharf.
Heute weckt ein Schlachterbeil abschreckende Assoziationen. Fast ebenso entsetzenerregendes Teufelszeug ist der S-förmige, am einen Ende zugespitzte Fleischerhaken. Es waren solche Haken, an denen in der Metzgerei grosse und kleine Fleischstücke in ihrer angestammten Form rot und blutig zum Verkauf bereit an einer Eisenstange oder an dem sogenannten Rechen hingen. Noch gibt es sie, die Fleischerhaken, doch mehrheitlich liegt heute das teure Fleisch möglichst appetitlich auf möglichst sauberen Platten in einer Auslage, im Kühlbuffet oder schon portioniert, ausgewogen, griffbereit verpackt im Regal zur Selbstbedienung. Kundinnen und Kunden wünschen sich Fleischwaren so vorverarbeitet, dass sie möglichst wenig an ihre tierische Herkunft erinnern.
Aber noch wetzt der Metzger sein Metzermesser am Wetzstahl, einem anderen, ebenfalls seit Jahrhunderten gebräuchlichen Berufswerkzeug. Und noch immer hat dieses Messerwetzen etwas Dramatisches, auch wenn es nur ein Bankmesser ist, mit dem von einem Stück eine Scheibe abgeschnitten wird, ein Entrecôte zum Beispiel, das dann erstaunlich genau dem gewünschten Gewicht entsprechend ohne die Frage «Darfs es bitzeli mee sy?» auf der Verkaufswaage landet.
Ein weniger kriegerisches, jedoch genauso unentbehrliches Werkzeug der Metzger war das flache Gefäss, mit dem beim Schlachten das Blut aufgefangen wurde. Im alten Bern wurden Schlachthof und Fleischbank entsprechend «d Schaal» genannt, und zwar, weil die Handlung, die diese Schale symbolisierte, von zentraler Bedeutung und fest im Bewusstsein des Metzgerstandes verankert war. Bis zur Industrialisierung des Schlachtablaufs im 19. Jahrhundert geschah das eigentliche Töten denn auch mit Würde und einiger Förmlichkeit; man schmückte das Tier mit Blumen oder bemühte einen Geistlichen, der seinen Segen gab.
Das aufgefangene Blut ging zwar in die Wurst, und diese wurde möglichst frisch verspeist, also neu einverleibt, jedoch mit Achtung vor höheren Zusammenhängen und im Bewusstsein, dass der Tod der einen Kreatur das Leben der andern ermöglicht. Lang ist es her, aber man vermutet, dass sich zu gewissen Zeiten das Handwerk des Metzgers mit demjenigen des Opferpriesters deckte oder dass die beiden sich wenigstens ergänzten.
In der mittelalterlichen Stadt waren die Metzger nahe beim Wasser zu finden. Nur dort, wo eine Quelle sprudelte oder reichlich Brunnenwasser floss, war minimale Reinlichkeit möglich. Trotzdem: Gemessen an heutigen Vorstellungen von Hygiene, dürfte eine solche Metzgerei ohne Kühlraum, ohne kontrollierte Belüftung und ohne adäquate Kanalisation nicht nur im Sommer für zarte Seelen eine deftige Zumutung gewesen sein. In Bern befand sich die «Schaal» im heutigen Konservatorium für Musik beim Schaalgässchen an der Kramgasse, nur eine Quergasse vom Münster entfernt. Als sich die Sitten ebenso wie der Geruchssinn der Stadtbewohner zunehmend verfeinerten, wurde das Metzgergewerbe von der Hauptachse weg eine Gasse zurück ins heutige Schlachthaustheater und dann, vor rund hundert Jahren, hinaus aus der Stadt in ein Industriegebiet verbannt.
Der Verdrängungsprozess vom Zentrum an die Peripherie dürfte ungefähr jener Entwicklung entsprechen, die das Ansehen des Handwerks des Metzgers selbst durchmachen musste. In einer Welt ohne gesicherte Nahrungsversorgung, in einer Welt, in der noch um das tägliche Brot gebetet wurde, weil sich der Tisch nicht wie selbstverständlich deckte, hatte es seine glorreichen Zeiten erlebt und
gesellschaftlich eine zentrale Bedeutung genossen. Mit der Entwicklung neuer Konservierungsmethoden und dem Aufkommen ungeahnter Transportmöglichkeiten verlor das lokale Metzgereigewerbe seine Unentbehrlichkeit und damit auch seine Privilegien und ganz beträchtlich an Status und Prestige.
Dem sprichwörtlichen goldenen Boden des Handwerks zum Trotz verschwanden auch andere ehrbare Berufszweige erst aus dem Zentrum und dann ganz aus der modernen Gesellschaft. Wo sind sie geblieben, die Müller, die Gerber, die Drechsler, die Küfer und Kessler? Und die Schmiede, die Schneider, die Sattler und Seiler? Noch vor wenigen Generationen fehlten sie in keinem Dorf und in keiner Stadt. In Bern gibt es zwar noch eine Gerberngasse, aber die Kesslergasse ist ebenso wie die Metzgergasse längst verschwunden. Letztere wurde unter anderem deshalb in Rathausgasse umgetauft, weil sich die Anwohner um ihren Ruf fürchteten, denn die Metzgergasse gehörte nicht zu den feinen unter Berns Adressen. Auch war von dem guten Dutzend Metzgereien, die ihr einst den Namen gaben, noch gerade eine Pferdemetzgerei übriggeblieben. Das Schicksal der anderen, grossen und kleinen, auf Würste, auf Innereien oder anderes spezialisierten Metzgerläden ist symptomatisch für das schweizweite Metzgereiensterben, das seit den 1960ern anhält und in seinen Ausmassen dem sogenannten Bauernsterben unbedingt vergleichbar ist.
Am Verschwinden ist denn auch das Berufsbild, das zu diesen kleinen bis mittleren gewerblichen Metzgereibetrieben gehörte. Jene Metzgermeister, die zusammen mit ihren Gesellen und Lehrlingen noch das Handwerk von A bis Zungenwurst ausüben und mit ihrer persönlichen Note bereichern, sind bald an einer Hand abzuzählen. Ihr ehrbarer Beruf ist längst teils industrialisiert, teils zu einer jener fragmentierten Wertschöpfungsketten moderner Betriebswirtschaft deklariert worden, in denen jeder Arbeitsschritt auf Rentabilität untersucht und gegebenenfalls ausgelagert wird. Das eigentliche Schlachten wird dabei mehrheitlich zentral und industriell erledigt und heisst jetzt «Fleischgewinnung». Die besonders arbeitsintensive Feinverarbeitung bleibt dagegen vor allem dem Gewerbe vorbehalten und wird im Bemühen um möglichst positive Signale nun «Fleischveredelung» genannt.
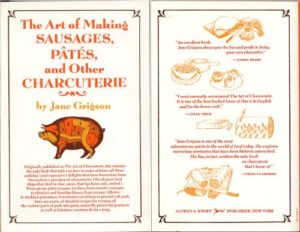 Noch gibt es sie zwar – in einzelnen edlen Bio-Nischen vielleicht sogar wieder vermehrt -, jene Alleskönner der Zunft, die sich vor einen Mastochsen stellen, diesem, sofern er noch welche hat, über die Hörner und über den Rücken schauen, damit sein Gesamtmass ins Auge fassen, um festzustellen, ob das Tier ihren Bedürfnissen entspricht. Sie öffnen ihm gekonnt das Maul und greifen an bestimmten Stellen kräftig ins Fell, lesen an den Zähnen das Alter ab und machen sich mit den Händen ein Bild vom Gesundheitszustand, vom Mästungsgrad und von der Qualität des Fleisches, schätzen dazu auch mit einer Fehlerquote von nur zwei, drei Dutzend Pfund das Lebendgewicht und die damit verbundene Schlachtausbeute, wie der verwertbare Teil des Tieres in der Fachsprache heisst.
Noch gibt es sie zwar – in einzelnen edlen Bio-Nischen vielleicht sogar wieder vermehrt -, jene Alleskönner der Zunft, die sich vor einen Mastochsen stellen, diesem, sofern er noch welche hat, über die Hörner und über den Rücken schauen, damit sein Gesamtmass ins Auge fassen, um festzustellen, ob das Tier ihren Bedürfnissen entspricht. Sie öffnen ihm gekonnt das Maul und greifen an bestimmten Stellen kräftig ins Fell, lesen an den Zähnen das Alter ab und machen sich mit den Händen ein Bild vom Gesundheitszustand, vom Mästungsgrad und von der Qualität des Fleisches, schätzen dazu auch mit einer Fehlerquote von nur zwei, drei Dutzend Pfund das Lebendgewicht und die damit verbundene Schlachtausbeute, wie der verwertbare Teil des Tieres in der Fachsprache heisst.
Kein einfaches Unterfangen, dieses Handwerk des Metzgers. Und alles andere als selbstverständlich. Denn wer vermag schon im aufrecht auf der Weide stehenden Rind sein geliebtes Filetsteak zu erkennen, oder wer weiss, wo genau sich nun die Zungenwurst versteckt? Bis es so weit ist, braucht es einiges an Fertigkeit und etliche ausgeklügelte Arbeitsgänge. Das fachgerechte Zerlegen des Schlachtkörpers ist übrigens eine Kunst, die schon mit dem Zerlegen der Beute bei der allerersten Jagd auf ein wildes Tier ihren Anfang genommen hat.
Sicher war es einst auch die schlichte rohe Kraft, die den Metzger und das Bild seines Berufes prägten. Zum Beispiel die Kraft, die es brauchte, in wahrer Knochenarbeit die Karkasse einer Kuh mit dem Beil mitten durch die steinharte Wirbelsäule hinunter in zwei Hälften zu spalten. Oder die Kraft, diese zentrigen Hälften in Hinter- und Vorderviertel zu teilen und auf dem Rücken wegzutragen. Das Bild vom wilden, rohen Schlachtergesellen war aber schon immer falsch, stand es doch im Widerspruch sowohl zu dem ethischen Selbstverständnis des Gewerbes als auch zu dem äusserst empfindlichen und wertvollen Rohmaterial, mit dem es umzugehen galt.
Eher als unbändige Kraft sind bei der Verarbeitung der Kostbarkeit Fleisch zunehmend komplexes Wissen über physische und chemische Vorgänge, dazu Geschicklichkeit und ein Sinn für Ästhetik gefragt. Auch ausgeprägtes Fingerspitzengefühl im Umgang mit einer ernährungkritischen und durch Skandale verunsicherten Kundschaft ist unerlässlich. Etlichen modernen Entwicklungen steht die Metzgerzunft gar schrecklich im Weg. Fett und andere tierische Nebenprodukte sind total out, sogar das Fleisch an sich ist für jüngere Generationen zunehmend ein schwieriges Kapitel. Aber noch geht die Liebe durch den Magen, noch werden pro Kopf und Jahr 60 Kilogramm Fleisch, einschliesslich Fisch und Geflügel, unters Volk gebracht.
Heute zählt der Verband Schweizer Metzgermeister 1458 Mitglieder. 1948 waren es 4079. Einer von ihnen war unser Vater, Paul Sterchi, der mit unserer Mutter damals ein Geschäft in der Berner Altstadt übernehmen konnte, nachdem beide während zweier Jahre im Emmental eine kleine Landmetzgerei geführt hatten. Wie viele andere Metzgerburschen – so wurden Metzgergesellen hierzulande genannt – stammte unser Vater von einem kleinen Bauernhof, wo er mit einem Lebensentwurf ausgestattet worden war, der nicht unbedingt vorsah, dass er einmal zu einem eigenen Geschäft kommen und sein eigener Meister sein könnte.
Typisch dagegen war, dass der Metzgerberuf auch seine Militärpflicht und seine Freizeit mitprägte. In der Armee, im und nach dem Krieg, leistete er seinen Dienst als Metzgersoldat bei der Verpflegung. Das heisst, er hatte zwei Ähren am Kragen und musste unter schwierigen Bedingungen üben, die Truppen aus Feldschlächtereien und Bunkern heraus mit Nahrung zu versorgen. In der knapp bemessenen Freizeit sang er in einem Metzgerchor.
Im Beruf gehörte er zu jener Generation von Stadtmetzgern, die ausser dem Schlachten sämtliche anfallenden Arbeiten selbst verrichteten und auch möglichst die ganze Schlachtausbeute fachgerecht verwerteten. Er besass das Wissen und das Können, ausser dem noch heute üblichen Sortiment an Fleisch und Wurstwaren auch so ausgefallene Dinge wie Presskopf oder Ochsenmaulsalat, aber auch Köstlichkeiten wie Mostbröckli oder Bündnerfleisch herzustellen. Letzteres ging, eingenäht in badewannengrosse Körbe, die bei der Güterspedition am Bahnhof auf eine Rampe geschoben wurden, auf die Reise nach Churwalden, um dort oben an der frischen Bergluft zu dem Luxusgut zu reifen, das es schon damals war.
Anfänglich gab es in seinem Laden noch heisse «Gnagi» mit Sauerkraut, sogar gekochtes Kuheuter, dessen kaum mehr üblicher Verzehr, bei allen feinschmeckerischen Vorbehalten, zumindest ökologisch betrachtet durchaus sinnvoll war. Oder er stellte Grieben her, «Gräubi» genannt, die sich, solange sie warm waren, allein durch den Geruch wie warme Semmeln verkauften. Eigentlich waren diese «Gräubi» nur der bräunliche Rest von festem Gewebe aus jenem Fett, das eingeschmolzen und als Schweineschmalz literweise in Henkelkesselchen abgefüllt wurde. «Zum Kochen und zum Braten» stand auf der Etikette. Auch diese Zeiten sind längst vorbei, und das einst als lecker geachtete und sogar als Brotaufstrich verwendete Griebenschmalz ist heute kaum mehr als ein Abfallprodukt.
Eher widerwillig stellte unser Vater im Winter auch Blut-und Leberwürste her. Immer am Montag, denn Montag war Schlachttag, und Blut, der verderblichste Teil der anfallenden Beute, wollte sofort verarbeitet sein. Blut an den Händen, an der Schürze war allerdings seine Sache nicht. Sein eigentlicher Platz war an der «Bank», hinter dem sogenannten Stock, beim Bedienen und Beraten eines treuen Kundenstammes. Dort war er «Der Metzger, Ihr Fleischfachmann» in Person: Er ging auf Wünsche ein, machte bei Unentschlossenheit zweckdienliche Vorschläge für den Menuplan und gab Hinweise zur Lagerung und Zubereitung der gekauften Waren.
Zunehmend hörte er hier auch kritische Fragen. Was genau ist die Maul- und Klauenseuche? Muss das sein, mit dem weissen Kalbfleisch? Wie ist das jetzt mit diesem Pökelsalz? Und enthält die Zungenwurst tatsächlich Zunge? Oder es galt zu erklären, dass im Cervelas tatsächlich viel Wasser enthalten sei, jedoch nicht in der Absicht, den Kunden zu hintergehen, sondern weil ohne die Zugabe von Wasser in Form von Eis weder ein Cervelas noch irgendeine andere Brühwurst hergestellt werden könnte. Was ich aber bei allem Respekt vor seinem fachlichen Können und Wissen noch heute bewundere, ist die Selbstverständlichkeit, mit der mein Vater sein erlerntes Handwerk nicht nur ausübte, sondern zum Mittelpunkt und zum eigentlichen Sinn seines Lebens machte. Wie die alten Meister besass er noch die Fähigkeit, seine Arbeit als Wert in sich selbst zu begreifen. Eine Liebe zum Beruf, ein von der Entlöhnung erst einmal unabhängiges Aufgehen in seinem Tun, das ich sonst nur bei anderen Gewerbetreibenden oder bei Künstlern gesehen habe.
Er besass ausser seinem eigentlichen Berufswissen eine ganze Reihe von Kompetenzen, die er während seiner Gesellenzeit wie beiläufig mitbekommen hatte und die man heute höchstens von einem Unternehmer erwarten würde. Die Buchhaltung und damit den Hauptteil der Schreibtischarbeit konnte er zwar unserer Mutter überlassen, aber organisatorisch, logistisch, strategisch oder wie das alles heute genannt werden müsste, war er gefordert. Und er bestand, ohne je eine diesbezügliche Ausbildung genossen zu haben, allein durch Fleiss und mit gewerblich gesundem Sach- und Menschenverstand.
Er zehrte dabei auch, so banal dies klingen mag, von einer dem Handwerk der Metzger eigenen, durch die Verderblichkeit des Rohmaterials aufgezwungenen Rationalität, die sich sehen lassen konnte. Da ist beispielsweise dieses schwer definierbare genaue Wissen, wann eine Arbeit für den nächsten Schritt aus der Hand gegeben wird, das bei aller scheinbaren Nichtigkeit schwierige Arbeitsabläufe verflüssigt. Es war auch dieses Wissen, das während der Industrialisierung in den Schlachthöfen zu jener Arbeitsteilung führte, die keinen Geringeren als Henry Ford zutiefst beeindruckte und ihn zur Erfindung des Fliessbandes inspirierte. Aus dem Demontageband des Schlachthofes entstand das erste Montageband der Autoindustrie.

Piece of Beef, 1923