
Weg von Espallion nach Estaing
Gehen. Darum geht es. Nur um das Gehen. Ich gehe.
Beharrlich gehe ich querfeldein. Ich gehe auf Hauptstrassen, ich gehe auf Naturstrasssen, auf Sumpf- und Saumpfaden, ich gehe auf Wegen aller Art.
Es führen viele Wege nach Rom, aber ich gehe in die andere Richtung, ich gehe auf dem Weg der Wege: Ich gehe auf dem Jakobsweg, auf dem Jakobsweg gehe ich nach Santiago de Compostela. Fünf Wochen lange gehe ich durch Dörfer und Städte. Durch Äcker und Felder und Weiden quer durch Spanien.
Ich gehe von morgens bis abends.
Manchmal bleibe ich stehen, schaue zurück.
Was?
So weit bin ich heute schon gegangen? Eben war ich doch noch in jener Stadt. Im Dunst am Horizont kann ich ihre Umrisse kaum mehr erkennen.
Ich gehe weiter, immer weiter.
Wenn ich meinen Wanderstcok nicht gegen kläffende Hunde erhebe, wenn ich ihn nicht als Stütze im Morast gebrauche, schlage ich damit den Takt. Bei jedem vierten Schritt stosse ich ihn neben meinen rechten Schuh in die Erde. Mein Stock verleiht mir Schwung; als wollte ich vom Boden abheben, drücke ich meine Fussgelenke durch, und mein Rucksack ist mir kein Gewicht, diese Steigung hier kein Hindernis.
Ich gehe über Stege und Brücken.
Ich gehe auf breiten, von Rädern gerillten Pflastersteinen. Der Glanz der Jahrhunderte liegt auf ihnen, ich gehe auf einem Wegstück, auf dem schon römische Legionen gingen.
Und da vorne, da ist ein kleiner Pass, gleich sehe ich über die Kuppe hinweg, und dann wird die Welt wieder grösser sein, stündlich wächst sie unter meinen Füssen. Was auf der Landkarte in meinem Kopf eben noch ein weisses Feld konturloser Erwartungen war, wird sich zu Steinen und Sträuchern, zu Dörfern, zu Menschen festigen.
Ich gehe.
Schritt für Schritt gehe ich weiter.
Manchmal bin ich nur noch, was ich sehe.
Ich bin der fliehende Vogel, der ins Gras hauchende Wind, der unter meinen Schuhen wegkollernde Kieselstein.
Manchmal bin ich nur der Schmerz meiner Blasen.
Und ich gehe unter der Pelerine im peitschenden Regen. Mittten in ein schändliches Gewitter bin ich gelaufen. Eine völlig durchnässte Gestalt in der baumlosen Landschaft, die stundenweit keinen Schutz bietet. Und ich versuche mich zu erinnern, wie man sich zu verhalten hat, um im offenen Gelände nicht vom Blitz getroffen zu werden.
Ich gehe mitten durch einen frisch gepflügten Acker. Die Schollen sind riesig, die aufgebrochene, feuchte Erde klebt an meinen Schuhen, hält mich zurück, verschlingt meine Kraft.
Oder ich gehe unter der gleissenden Sonne, ich gehe durch den Backofen, der Spanien sein kann. Es ist Wahnsinn, in so eine Ebene hineinzulatschen. Dieser Weg! Nichts als eine sich in der Weite verlierende, ausgedörrte Grasnarbe, zwei Krähen lachen. Am Wegrand nur Disteln, sonst links und rechts Weizen. Flach wie Saskatschewan. Ich sehe den ganzen Tag keinen Menschen. Ich atme durch die Nase, mein Mund ist ausgetrocknet. Die Feldflasche ist leer. Ich habe mich verlaufen. Stundenlang kein Brunnen, kein Dorf, aber dort, sind das nicht Häuser? Endlich Wasser, Schatten, eine Kneipe! Und ist das nicht …? Aber was aussah wie eine wunderschöne, runde, rote Coca-Cola-Reklame, ist aus der Nähe ein verrostetes Stassenschild am Eingang eines gespensterhaft leeren Dorfes. Die meisten Lehmmauern sind bereits eingestürzt oder am Abbröckeln. Kaum Schatten ist zu finden, keine Katze zu sehen.
Zu oft, viel zu oft gehe ich auf der Hauptstrasse. Wenn ich auf der Strasse gehe, ist mein Kopf überall und nirgends. Ich muss mich vor den Autofahrern hüten. Keinen halben Meter weichen sie von ihrer Ideallinie ab. Sie nageln mich an die Leitplanken, sie lassen mich aufgeschreckt zur Seite springen, sie bespritzen mich mit Kot.
Wenn ich auf der Strasse gehe, gehe ich über Leichen: Igel, Maulwürfe, Vögel, Echsen, Raupen, Mäuse, Dachse, Katzen, Käfer, Frösche, Hasen, Hunde, Hühner. Alle tot. Ich zähle sie schon sei Tagen nicht mehr.
Wenn ich auf der Strasse geh, bin ich nichts.
Durch ein Wirrwarr von Strassen stehle ich mich aus einer der viel zu schnell aus dem Boden gestampften Vorstädte. Anstelle von Gehsteigen unsäglicher Schutt, stinkender Müll. Ich gehe vorbei, werde angehupt, angeschrien. Ich spüre, wie ich in all der rasenden Hässlichkeit aggressiv, wie ich innerlich selbst asphalthart und zementgrau werde.
Gehen. Darum geht es.
Jetzt gehe ich über einen Pfad, der sich in der Ferne verliert, durch ein Feld voller Kerbel. Wie Sternenkonstellationen kommen mir die Anordnungen der gelben Blüten vor. Störche fliegen auf, ziehen Schleifen.
Oder ich gehe mitten durch ein Weizenfeld. So weit ich sehe: Weizen.
Ich hebe im Gehen meinen linken Arm, fühle, wie die Ähren unter meinen Handfläche wegstreichen. Mein Weg ist ein Fuss breit gestampfte Erde mitten im wogenden Brot. Das Wandern ist des Müllers Lust. Jetzt sehe ich die Abdrücke der Hufe eines Pferdes. Da rechts erkenne ich die Umrisse einer romanischen Kapelle, dort, weit vorne, über dem Weizen, kommt die Spitze des Kirchturms des nächsten Dorfes zum Vorschein.
Ich gehe wie ohne Gewicht, ausserhalb der Zeit.
Aber, wer heute für sich das Gehen entdeckt, hat deshalb noch lange nicht das Pulver erfunden.
Ein Pilger ist …
Bin ich ein Pilger?
Was sagt der Herr zum armen Kain?
Ein Pilger ist …
Hinter mir liegen das Hospiz und die Kirche von San Juan de Ortega in Kastilien. Sie wurden inden einst wilden, von Weglagerern unsicher gemachten Bergen von Oca zum Schutz der Jakobspilger errichtet. Zogen Unwetter und Nebel auf, halfen die drei Glocken im Turm den Schafen des Herrn zurück auf den Weg.
Noch heute kümmert sich hier ein Priester um das Wohl der Vorbeiziehenden. Er heisst José Maria, hat auffallend grosse Ohren und ein herzliches Kichern. Wenn er an sein Stumpen zieht, um den er Zigarettenblättchen wickelt, sieht er ganz unpriesterlich wie Lino Ventura aus.
Eine Knoblauchzuppe hat er gekocht. Die schmeckte vorzüglich. Und darüber, was ein Pilger ist, haben wir gestritten. Don José Maria liess weder esoterische noch politische oder gar grüne Morive gelten. Von einer möglichen Protestform der Jugend, die, aus ganz Euroa kommend, auf dem Jakobsweg Luft holt und gleichzeitig gegen eine immer absurder werdende Raserei angeht, wollte er schon gar nichts wissen. „Nein“, wettert er gutmütig: „Gehen mag für Körper und Geist sehr gesund sein, aber unser camino, so wird der Jakobsweg kurz genannt, unser camino ist kein Psychoseminar für den Sommerurlaub! Der echte Pilger, der glaubt! Und zwar an Gott!“
Aber jetzt, am Tag danach, habe ich es im Kreuz. Ich weiss nicht, ob es wegen des zu harten Lagers oder wegen der Nässe des gestrigen Gewitters ist.
Ich bin plötzlich ein Halbinvalider mit Blasen an untauglichen Füssen. Ich gehe nicht mehr, ich quäle mich unter meinem Rucksack voran, hänge an dessen Riemen, als wäre er ein Fallschirm. Ich bin ein Quasimodo, der sich nach Spanien verhumpelt hat, der kau die Kraft besitzt, die Drähte in den Pforten der Viehzäune zurück über die Pflöcke zu spannen.
Was stolpere ich durch diese verlassene Hochebene?
Wozu? Was suche ich hier?
Keiner Kuh, keinem Kalb begegne ich.
Ich fluche.
Der schief gegangene Weg ist mir ein zweifelhaftes Ziel. Ich schwöre, schon im allernächsten Kaff mit diesem Unsinn Schluss zu machen. Was vertue ich hier meine Tage? Längst nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Was habe ich auf Spaniens versumpften Viepfaden verloren, was gehen mich diese Ruinennester anb? Ich pfeife auf ihre komische Kunst, ich pfeife auf ihre komische Geschichte. Hier bin ich doch nur ein wandelnder Gratiswebespot für eine Kirche, mit der ich nichts, aber auch gar nichts am Hut habe.
Ein Pilger ist …
Schon einmal wollte ich aussteigen. Tage zuvor, in der Gegend von La Rioja, kurz hinter Logroño. Der Weg führte wieder einmal der Hauptstrasse entlang. Es herrschete grauenhafter Verkehr. In jedem Kleinwagen ein Kamikaze, jeder Laster hatte eine Rauchfahne am Auspuff, als wäre er ein Ozeandampfer. Mir war, als ob ich gegen einen Strom anschwimmen müsste. Ich fuchtelte mit meinem Stock, war den Gesichtern hinter den Lenkrädern hasserfüllte Blicke zu. ich schritt böse aus, bis ich plötzlich, beim Eingang zu einen Friedhof am Strassenrand, vor eiegenartigen Figuren stand.
In den Steinsäulen des Friedhofportals waren Pilger gehauen. Pilger, die mit leidenden Gesichtern mit sich selbst rangen. Sie zogen sich am eigenen Gewand durch den Regenb, zerrten sich an den eigenen Haren voran, sie kämpften mit dem Drachen, und – so schien es mir – sie assen das Brot der Erkenntnis.
Über mich selbst lachend war ich weitergegangen.
Auch jetzt steige ich nichg aus. Schon gehe ich wieder lockerer. Wozu aussteigen? Das ganze Leben ist eine Pilgerfahrt. Und wie sprach der Herr zu armen Kain?
Man sagt, man könne sich auf machen als Wanderer, als Sportler, Kunsthistoriker, als Abenteurer, Landstreicher oder Naturfreund, aber früher oder später werde jeder, der sich auf diesen Weg begebe, zum Pilger.
Man sagt, spätestens ins Santiago de Compostela reihe sich jeder und jede unter die Gläubigen und den Heilsuchenden ein, betreten denn wie diese das eigentliche Ziel des Weges, die Kathedrale, durch das Westportal, und erweise dort in der Säulenhalle der Seligkeit dem Apostel Jakobus die Reverenz.
Ein Pilger ist …
Als ich mich aufmachte, hatte mich beim Abschied ein Freund gefragt, wo ich denn meine Jakobsmuscheln hätte?
„Welche Jakobsmuscheln?“
„Die Muscheln,die sich alle Pilger, die nach Santiago gehen, um den Hals hängen.“
„Aber ich bin doch kein echter Pilger“, hatte ich geantwortet.
„Hast du Dir etwa auch keine Verprechen abgenommen? Hast du keine Wünsche, die in Erfüllung gehen sollen? Oder machst Du armer Sünder gar eine Busswallfahrt?“
Ein Pilger ist …
Längst schreite ich wieder leicht und zügig aus. Die Weidelandschaft ist mir ein Teppich. Schon sehe ich die nächsten beiden Dörfer. Wie von Hand sind die ockergelben Häuser um die Kirchen un die Gegend gestreut.
Was weiss ich denn?
Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Dies sprach der Herr bereits zum armen Kain. Es macht einfach Spass zu gehen. Ich gehe weiter, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, und ich freue mich über das Pilgerkreuz am Wegrand. Es weist mir die Richtung, erinnert mich an all die anderen Wanderer, die es durch die Jahrhunderte schon grüsste.
*
Der Weg ist alt, der Weg ist berühmt.
Zu seiner eigentlichen Blütezeit im Mittelalter wurde er von Millionen begangen, er liess Dörfer und Städte entstehen. Seinetwegen wurden Klöster gegründet und etliche der schönsten romanischen und gothischen Kirchen gebaut.
Im Mittelalter begegneten und vermischten sich auf dem Jakobsweg die Kulturen Europas, Pilger aus sämtlichen christlichen Gegenden kamen und sahen und nahmen und gaben und beteten.
Jeder Stein am Rand des Jakobsweges hat eine Geschichte zu erzählen.
Da waren Geschäftemacher wie der billige Jakob unterwegs. Es gab Taschendiebe, Wegelagerer, Hochstapler aller Art. Die coquillards (von französisch coquille, Muschel), die François Villon in einem Galgenvers verewigte, trieben ihr Unwesen mit gutgläubigen Pilgern. Falsche Priester liessen beichtende Sünder zur Ader, ein ambulantes, leichtes Gewerbe fehlte nicht.
Wahlfahrende Handwerker liessen manch ein Gesellenstück, aber auch etliche Meisterwerke zurück. Steinmetzen und Bildhauer unterbrachen ihre Reise oft jahrelang, um an den entscheidenden Kirchen, Klöstern und Brücken zu Ehren des Apostels Hand anzulegen. Für die Freimaurer gehörte eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela zu der religösen und handwerklichen Ausbildung. Aus ihrem Kreis kamen mehrere, später dafür heiliggesprochene Wegbereiter, Pilgerfreunde und Brückenbauer.
Im Mittelalter war eine Wallfahrt auch ein gesellschaftlich akzeptables Schlupfloch aus der Enge des Alltags. Nicht wenigen dürfte die Pelerine (von französisch pelerin, Pilger) als Deckmantel für die Lust am Abenteuer oder für temporäres Aussteigen gedient haben.
Die ganz besondere Gruppe der Strafpilger kam noch dazu. Als kleinere oder mittlere Missetäter hatten sie von der
Obrigkeit die Wahl erhalten, anstatt in den Kerker nach Santiago de Compostela zu wandern. Zum Beweis, dass sie dies auch wirklich taten, führten sie eine Pilgerkarte auf sich, die sie unterwegs an offiziellen Stellen abstempeln liessen. Dass mit diesen Dokumenten Handel getrieben wurde, kann kaum überraschen. Wer es sich leisten konnte, kaufte sich eine, die bereits vol,lgestempelt war, und liess sich dann an einem geeigneten Ort für ein halbes Jahr nieder.
Überraschend ist vielleicht, dass es in Belgien die Pilgerschaft nach Santiago de Compostela als Alternativstrafe weiterhin gibt. Die mit Taschengeld und einem Zelt ausgerüsteten, zumeist jugendlichen Straftäter pflegen in kleinen Gruppen etwas abseits zu gehen. Heute werden sie von Sozialarbeitern begleitet.
Im Mittelalter erlebte er seine besten Jahre, aber der Weg der Wege wurde schon in vorchristlicher Zeit begangen. Er führte einfach unter der Milchstrasse dahin, immer Richtung Sonnenuntergang, bis zum Ende der Welt, bis nach Finisterre, bis zum Atlantik, der, am äussersten Ende der Welt, am äussersten Ende des Festlandes, für die Kelten das Meer der Toten war.
Später hätten sich unter den Römern verfolgte Druiden mit ihrem verbotenen Wissen in diesen fernen, unzugänglichen Winkel von Spanien abgesetzt. Der Weg sei deshalb zu einer Initiationsroute geworden. Wer ihn beging, der suchte geheimes Wissen, innere Perfektion und Erleuchtung. Dies behaupten zumindest die Esoteriker von heute.
Bekannt und berühmt sind allerdings die meigas von Galicien. Eine meiga ist eine Art Hexe, vielleicht eine Nachfahrin der keltischen Druiden. In manch einem Dorf verfügt sie weiterhin über ebensoviel Autorität wie ein Priester oder ein Arzt.
Einer gewissen, geheimnisvollen Dimension dieses Weges vermag sich auch der ganz gewöhnliche Pilger nicht zu entziehen. Ist es die wechselhaft, ja launische Landschaft? Bald droht sie unergründlich, dann beflügelt sie mit ihrer übernatürlichen Exotik die Einbildungskraft. Unzählige Symbole wollen erkannt und gedeutet sein, allerleis Zeichen am Wegrand beunruhigen die Sinne. Aufeinmal scheinen Bäume etwas sagen zu wollen und ein schwarzer Vogel ist nicht mehr einfach ein Vogel.
Die christliche Kirche entdeckte den magischen Weg im neunten Jahrhundert. Ähnlich wie sie es mit anderen heidnischen Institutionen tat, wusste sie ihn für ihre Zwecke zu adoptieren.
Das Christentum war damals in Bedrängnis geraten. Seine Südwestflanke, die Iberische Halbinsel, stand zum grösseren Teil unter der Herrschaft der Mauren. Nur das heutige Galicien, das wie das Baskenland weder völlig christianisiert noch sehr zivilisiert war, interessierte die islamischen Eroberer wenig. Es war eine wilde, unnütze Gegend, die man sich ruhig eien bisschen wie das isolierte Dorf von Asterix und Obelix vorstellen darf.
Aber dahin galt es nun die Aufmerksamkeit der Christen zu lenken, dahin mussten Glaube und Kraft für die Rückeroberung der verlorenen Gebiete kanalisiert werden. Der Kanal bestand, allein es fehlte deas christliche lockende Ziel.
Nichts weniger als ein Apostel wurde, o Wunder!, in einer nicht nachvollziehbar reliquienverrückten Zeit ausgegraben. Der besagte Apostel war seinen historisch erfassten Märtyrertod zwar ungefähr am entgegengesetzten Ende der damaligen Welt gestorben, aber das entdeckte Grab hätte kirchenstrategisch kaum günstiger liegen können.
Die Lücken in den Fakten wurden mit Wundern überbrückt, die Legende wurde mit der Wirklichkeit verwoben und zurechtgebogen, der Pabst winkte mit Sündenerlass für alle, die durch das gefährlich Gebiet zu dem Apostel pilgerten, und der Jakobskult ward geboren. Mit ein paar zusätzlichen, über den Weg verstreuten Reliquien wurde nachgeholfen, bis sie kamen, immer zahlreicher, zu der Grabstätte, von der man weiss, wenn man es wissen will, dass sie die des Apostels nicht ist.
Zeitweise habe Santiago de Compostela als Wallfahrtsort Jerusalem und sogar Rom überflügelt. Allen voran sein scho Karl der Grosse geritten. Seine Sünden habe er auf eine Pergamentrolle geschrieben, die er bei seiner Ankunft an der heiligen Grabstätte auf den Altar gelegt habe, um heftig und reuig in die freien Hände schluchzen zu können. Als später sein Pergament wieder aufgerollt habe, seien die Buchstaben verschwunden, somit seine Sünden getilgt gewesen.
Der Wunder war fortan kein Ende mehr. Der Apostel öffnete Türen und Herzen, heilte und linderte und griff immer häufiger entscheidend in den Kamf gegen die Muselmanen, in die Rückeroberung der iberischen Halbinsel ein.
Wo immer Not am Manne war, tauchte er plötzlich auf, mit gezücktem Schwert und hoch zu Ross. Santiago Matammoros – der Mohrentöter – hiess er jetzt. Sein Name war zum Schlachtruf der Christen geworden, und die ihn umrankenden Legenden wucherten ungezählt.
*
Ich gehe durch Kastilien.
Ich habe den Wind im Gesicht, Weizengruch in der Nase. Es ist spät nachmittags. Ich komme gut voran. Kastilien ist anders, Kastilien ist schön.
Eben habe ich in dem kleinen Städtchen Frommista die St. Martinskirch besucht. Sie ist ein Juwel romanischer Baukunst, einer der architektonischen Hähepunkte des Jakobsweges. Eien wunderschöne kleine Kirche. Mit sämtlichen romanischen Vorzügen. Dreimal bin ich um sie herumgegangen, dann ich ging ich weiter.
Bis Villalcázar de Sirg will ich heute noch gehen. Die Karte in meinem Pilgerführer verspricht einen kleinen, historischen Ort. Einen Laden und eine Taverne soll es dort geben. Auch ein refugio, eine jener von Kirche oder den Gemeinden dem Jakobsweg entlang zur Verfügung gestellten Unterkunftsmöglichkeiten.
Aufgebrochen bin ich im Morgengrauen in Castrojeriz, in der Provinz von Brugos. Die ersten vier oder fünf Wegstunden ging ich mit dem Franzosen Godefroy V.
Wie gingen hintereinander, wir gingen nebeneinander. Wir redeten, und wir schwiegen.
Bald sechzig, ist Godfroy sehr rüstig. Vor zwei Monaten hat er in seinem Wohnort in der Nähe von Lyon den Rucksack gepackt, die Jakobsmuscheln umgehängt un den Pilgerhut genommen. Er erzählt von den Schwierigkeiten mit dem Strassenverkehr, mit der Polizei. Anders als in Spanien, ist der Jakobsweg in Frankreich kaum mehr eine bekannte Institution. (Das hat sich inzwischen geändert, nicht zuletzt Dank Filmen wie: Saint-Jacques… La Mecque )
Wer zu Fuss geht, ist verdächtig.
Wie bei andern Pilgern, mit denen ich gegangen bin, erfuhr ich viel über Godfroy, er wohl viel über mich. Im stundenlangen Gehen ergeben sich entweder echte Gespräche oder nichts.
Als Godfroy am Wegrand auf einem Spirituskocher sein Mittagsmal zu kochen begann, war ich weder müde noch hungerig, und ging, meinen Rhythmus haltend, weiter.
Jetzt gehe ich einer Bewässerungsanlage entlang. An einem Baum ist ein gelber Pfeil. Der Weg zweigt hab. Seit zwei Wochen folge ich diesen gelben Pfeilen. Wenn ich sie übersehe, bin ich auf meinen Pilgerführer angewiesen. Oder ich muss, wenn jemand in der Nähe ist, meinen Weg erfragen.
Da vorne sind Häuser. Población de Campos heisst der Ort.
Im Schtten einer Pappelallee sitzt ein Dutzend alter Männer in Reih und Glied auf einer Mauer. Sie halten abgearbeitete Hande auf dem Stock zwischen schwach gewordenen Beinen.
Sie gucken, grüssen, ich grüsse zurück.
„A Santiago?“ fragt einer.
„A Santiago“, antworte ich.
In der Dorfschenke bestelle ich einen Kaffee und ein Glas Wasser. Die Bedienung lächelt. Auch sie fragt, ob ich nach Santiago will. Sie lässt mich nicht bezahlen.
„Ich lade dich ein, armer Pilger. Bis Santiago sind es noch 390 Kilometer!“
Ich bedanke mich und freue mich, denn ich befinde mich ziemlich genau in der Mitte meines Weges.
Durch ein lichtes Wäldchen gehe ich aus dem Dorf hinaus. Schafe weiden im hohen Gras. In eine braune Decke gehüllt, lehnt der Schäfer an einem Baum. Er hebt eine knorrige Hand zum Gruss.
Ich gehe weiter durch die uferlose kastilische Ebene. Sie ist kaum zu beschreiben. Imposant ist vielleicht das
Wort.
Mein Gehen hat sich längst selbstständig gemacht.
Es geht.
Im klaren Abendlicht kommt Villalcázar de Sirga zum Vorschein. Eine gigantische, im 13. Jahrhundert von den Tempelrittern auch als Burg konzipierte Kirche überragt das kleine Dorf. Als duckten sie sich vor Wind und Sonne, sind die Häuser flach und niedrig.
Über einen der geraden, sternförmig um die Kirche angelegten Wege komme ich aus der Ebene ins Dorf. An wuchtigen Stalltüren in Mauern aus Strohziegeln geh ich vorbei. Schmiedeiserne Beschläge zieren das geschnitzte Holz. Ein Bauer rattert auf einem Traktor heran und grüsst. Auf einem Kamin nisten Störche.
Die hoch aufragende gotische Kirche wirkt beschädigt, teilweise eingestürzt, die Säulen im Portal stehen schief, aus Fugen und Ritzen wächst Gras, aber eine schönere, eine menschlichere Kirche habe ich noch nie betreten.
Ihr gegenüber am Dorfplatz befindet sich in einem Steinhaus mit einem Vordach auf Holzpfeilern die renovierte Pilgertaverne. Neben der Rundbogentür hängt eine Glocke, zwei schwere Essgabeln rosten an der Wand.
Bevor ich eintrete, werfe ich noch einmal einen Blick zwischen den Häusern hindurch auf die in der Abendsonne leuchtenden Kornfelder. Der Blick ist nachhaltig wie der erste Blick aufs Meer.
Auf einem der Eigentische in der Taverne steht ein Krug mit Wein, ein Korb mit Brot. Ich esse mit einem Holzlöffel die dampfende Suppe aus einer Tonschale, höre gleichzeitig stampfende Schritte und dem kleinen Vordach. Ich ruhige Stimmen müder Wanderer.
*
Auch sie werden essen, dann werden sie sich um die Blasen und um die Druckstellen an ihren Füssen kümmern. Sie werden tief schlafen, und morgen werden sie weitergehen.
Sehr anders wird es nie gewesen sein.
Gehen.
Wir haben Brot und Käse eingekauft. Dazu eine Büchse Sardinen. Ich gehe mit einem Weggenossen.
„A Santiago?“
An dem Dorfbrunnen, wo wir trinken, weist uns eine bejahrte Frau zahnlos lächelnd die Richtung.
Der Weg beginnt zu steigen, kurvt ein enges Tal hinauf. Aber es geht leicht über diese durch die Jahrhunderte von Pilgerstiefeln abgewetzten Steinplatten.
Kinderjauchzen kommt von einem Waldrand herüber. Eine Bauernfamilie wendet vielköpfig das Heu am steilen Hang. Grün, sehr unspanisch grün, ist die Landschaft geworden. Ich höre meinen Stock, hinter mir denjenigen meines Gefährten, weiter unten das Sprudeln einer Quelle.
Ein Vogel hockt sich noch schnell vor uns auf den hohlen Weg, um gleich über einen blühenden Ginsterbusch hinweg zu verschwinden. Im Unterholz raschelt die geflüchtete Echse.
Und dort zeigt sich ein Strohdach. Runde Steinhäuser. Das müssen die keltischen pallozas sein. Ein Hund kommt angekläfft. Er lässt sich vom schlaff ausgestreckten Arm beruhigen, kommt herbei, leckt meine Hand. Am nahen Horizont steht vor dem blauen Himmel ein weisses Pferd, schwarmweise flattern Schmetterlinge daher.
Der Schimmel hebt den Schweif.
Auf der anderen Seite dieser Passhöhe, wir wissen es: Galicien! Ob man den Atlantik sieht? Und noch rund eine Woche bis Santiago!
„Mystisch“, sage ich.
Dieser Weg ist einfach mystisch.
Aber was heisst schon mystisch, wenn nicht, so zu tun, als gäbe es mehr zu sagen, als man sagen kann.
(März 1989)
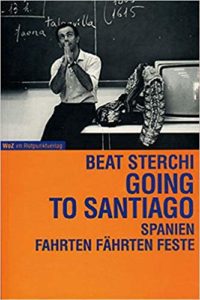
Aus: Beat Sterchi, Going to Santiago, Spanien, Fahrten Fährten Feste, (Rotpunktverlag 1995)
Weiter auf dem Jakobsweg nach Rüeggisberg